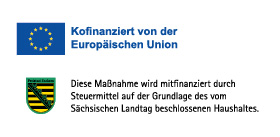Zwischennutzung von Brachflächen: Chancen für Klima, Stadtbild und Soziales
In vielen Städten schlummern sie: ungenutzte Brachflächen, ehemalige Industrieareale, leerstehende Grundstücke und Baulücken, die auf ihre „Wiederbelebung“ warten. Was auf den ersten Blick als Zeichen städtischer Dysfunktionen wirkt, birgt ein enormes Potenzial – für Klimaanpassung, soziale Innovation und städtebauliche Experimente. Der Schlüssel dazu: Zwischennutzung.
Was ist Zwischennutzung?
Zwischennutzung bezeichnet die zeitlich befristete Nutzung von Flächen, die aktuell nicht dauerhaft gebraucht oder genutzt werden. Oft ist ihr langfristiges Schicksal unklar – Eigentumsverhältnisse sind ungeklärt, Bauprojekte verzögern sich oder es fehlt an Investoren. Statt diese Flächen ungenutzt zu lassen, können kreative, klimafreundliche und gemeinschaftsorientierte Ideen temporär Raum bekommen.
Klima-Chancen durch grüne Zwischennutzung
Gerade im Kontext der Klimakrise gewinnen solche Flächen strategisch an Bedeutung:
- Urbanes Grün auf Zeit: Temporäre Parks, Gemeinschaftsgärten oder bepflanzte Flächen schaffen Kühlungseffekte, speichern Wasser und verbessern das Mikroklima – gerade in dicht bebauten Quartieren.
- Wassermanagement: Offene Flächen bieten Potenzial zur Umsetzung von Schwammstadt-Prinzipien – etwa zur Rückhaltung von Regenwasser bei Starkregenereignissen.
- Biodiversität fördern: Wildwiesen oder Blühstreifen auf Brachflächen schaffen wichtige Trittsteinbiotope für Insekten und Vögel.
Stadtbild und Gestaltungsexperimente
Zwischennutzung kann das monotone Stadtbild aufbrechen:
- Gestalterische Freiräume: Architektonische Experimente, Kunstinstallationen oder temporäre Bauten bringen Dynamik ins Stadtbild.
- Flexibles Städtebau-Labor: Planungsprozesse können durch temporäre Lösungen getestet werden – z.B. wie ein Platz als Begegnungsort funktioniert oder ob eine Verkehrsberuhigung angenommen wird.
Soziale Dimensionen
Nicht zu unterschätzen ist das soziale Potenzial:
- Beteiligung ermöglichen: Zwischennutzungen laden oft zur aktiven Mitgestaltung durch Bürger:innen ein – von Urban Gardening über Pop-up-Kultur bis hin zu Bildungsprojekten.
- Niedrigschwellige Angebote: Sie bieten Raum für Kultur, Soziales oder Freizeitgestaltung – besonders in Quartieren mit geringer Aufenthaltsqualität.
- Kollektive Aneignung: Zwischennutzungen fördern das Gefühl, dass Stadtgestaltung nicht nur von oben kommt, sondern durch Teilhabe geprägt ist.
Herausforderungen und Erfolgsfaktoren
Trotz der Chancen ist Zwischennutzung kein Selbstläufer. Sie braucht:
- Kooperationsbereitschaft der Eigentümer:innen
- Klare rechtliche und zeitliche Rahmenbedingungen
- Unterstützung durch Kommunen, z.B. über Zwischennutzungsagenturen
- Einbindung lokaler Initiativen und Akteur:innen
Fazit:
Zwischennutzungen sind keine bloßen Lückenfüller – sie sind Reallabore für eine klimaresiliente, vielfältige und gemeinschaftlich gestaltete Stadt. Sie zeigen, wie wir mit temporären Lösungen langfristige Impulse setzen können. In Zeiten von Klimawandel, Flächenknappheit und sozialer Fragmentierung sind sie mehr als nur ein Übergang – sie sind ein Werkzeug für eine bessere urbane Zukunft.