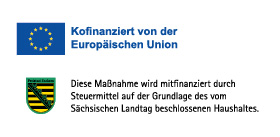Waldverlust: Die stille Bedrohung für sauberes Trinkwasser
Im Juli 2025 machte der MDR in einer bereits 2023 ausgestrahlten Dokumentation auf ein Thema aufmerksam, das bislang oft unter dem Radar lief: Die Verbindung zwischen dem Zustand unserer Wälder und der Sicherheit unserer Trinkwasserversorgung. Was auf den ersten Blick nach zwei getrennten Themen klingt, ist in Wahrheit eng verknüpft – und betrifft uns in Deutschland direkter, als viele glauben.
Wälder – die stillen Wasserwerke
Wälder sind weit mehr als grüne Kulisse. Sie wirken wie natürliche Wasseraufbereitungsanlagen:
-
Filterwirkung: Der humusreiche Waldboden hält Sedimente, Schadstoffe und Nährstoffe zurück. Das Wasser, das ins Grundwasser sickert, ist dadurch oft von hoher Qualität.
-
Wasserspeicher: Waldböden speichern enorme Mengen Wasser und geben es langsam wieder ab – wichtig, um Quellen und Talsperren auch in Trockenzeiten zu speisen.
-
Klimaregulation: Über Verdunstung kühlen Bäume ihre Umgebung und beeinflussen sogar den regionalen Niederschlag.
Diese Funktionen sichern nicht nur sauberes, sondern auch stetig verfügbares Trinkwasser.
Wenn der Wald stirbt, leidet das Wasser
Der Verlust von Wald – sei es durch Dürre, Borkenkäfer oder Rodung – hat direkte Folgen für unsere Wasserversorgung:
-
Mehr Schadstoffe im Wasser: Ohne Wurzeln und Humus werden Nitrate, Phosphate und Sedimente leichter ausgewaschen. Die Wasserwerke müssen dann mehr und teurer aufbereiten.
-
Erosion und Sedimenteintrag: Abgespülte Erde lagert sich in Talsperren ab, verringert deren Speicherkapazität und verschlechtert die Rohwasserqualität.
-
Weniger Grundwasserneubildung: Geschädigte Böden lassen Wasser schneller oberflächlich abfließen, statt es zu speichern.
-
Trockenere Landschaften: Ohne den kühlenden Effekt der Wälder heizen sich Einzugsgebiete stärker auf – ein Teufelskreis für die Wasserverfügbarkeit.
Beispiel Harz – „Wasserburg“ in der Krise
Der Harz gilt als „Wasserburg“ des Nordens und speist zahlreiche Talsperren, die Millionen Menschen versorgen. Doch Trockenjahre und großflächige Waldschäden setzen dem System zu:
-
Füllstände im Minus: Mitte Juli 2025 waren die westharzer Talsperren nur zu rund 53 % gefüllt – deutlich weniger als im langjährigen Mittel.
-
Schlechtere Rohwasserqualität: Abgestorbene Fichtenflächen führen zu mehr Sediment- und Nährstoffeinträgen.
-
Technische Aufrüstung: Wasserwerke investieren in moderne Aufbereitung wie Ozon-Biofiltration, um schwankende Qualitäten abzufangen – Kosten, die letztlich die Verbraucher tragen.
Häufiges Missverständnis: „Mehr Wald verbraucht mehr Wasser“
Zwar verdunsten Bäume Wasser, doch intakte Wälder stabilisieren die Wasserversorgung insgesamt. Sie sorgen für saubere Quellen, gleichmäßigere Abflüsse und verringern das Risiko teurer Aufbereitung. Entscheidend ist, dass Wälder standortgerecht und klimaangepasst bewirtschaftet werden.
Was jetzt nötig ist
-
Wald als Wasserinfrastruktur begreifen und entsprechend schützen.
-
Mischwälder fördern, um Resilienz gegen Trockenheit und Schädlinge zu erhöhen.
-
Einzugsgebiets-Partnerschaften zwischen Forst, Landwirtschaft und Wasserwirtschaft ausbauen.
-
Frühwarnsysteme wie den Dürremonitor konsequent nutzen.
-
Prävention statt Reparatur – intakte Wälder sind langfristig günstiger als jede nachträgliche Wasseraufbereitung.
Fazit
Der Zustand unserer Wälder ist ein Gradmesser für die Sicherheit unserer Trinkwasserversorgung. Der MDR-Beitrag hat es auf den Punkt gebracht: Waldschutz ist Wasserschutz. Wer die Wälder stabilisiert, sorgt nicht nur für Artenvielfalt und Klimaschutz, sondern schützt auch die Grundlage unseres Lebens – sauberes Trinkwasser.