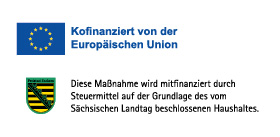Die Idee der Pocket Parks
Die Idee der Pocket Parks (auf Deutsch oft als „Taschenparks“ oder „Mini-Parks“ bezeichnet) stammt aus der Stadtplanung und Landschaftsarchitektur. Dabei handelt es sich um kleine, meist weniger als 1.000 Quadratmeter große Grünflächen, die in dicht bebauten städtischen Gebieten geschaffen werden. Sie nutzen ungenutzte oder untergenutzte Flächen wie brachliegende Grundstücke, Baulücken oder ehemalige Parkplätze und verwandeln sie in öffentliche, begrünte Aufenthaltsorte.
Ziel und Nutzen von Pocket Parks:
-
Erhöhung der Lebensqualität: Sie bieten Erholungsräume im direkten Wohn- oder Arbeitsumfeld und fördern so das Wohlbefinden der Stadtbewohner:innen.
-
Soziale Treffpunkte: Pocket Parks schaffen Orte der Begegnung und fördern das Gemeinschaftsleben in der Nachbarschaft.
-
Klimaanpassung: Durch Begrünung verbessern sie das Mikroklima, spenden Schatten und reduzieren Hitzeinseln.
-
Ökologische Wirkung: Sie bieten Lebensraum für Pflanzen und Tiere, fördern die Biodiversität und tragen zur Verbesserung der Luftqualität bei.
-
Niedrigschwellige Aufenthaltsqualität: Sie ermöglichen kurze Aufenthalte und Pausen im Alltag – zum Beispiel zum Lesen, Entspannen oder für ein kurzes Gespräch.
Typische Merkmale:
-
Begrenzte Fläche, oft nur einige hundert Quadratmeter
-
Sitzgelegenheiten, Bäume, Sträucher, Blumenbeete
-
Teilweise mit Spielmöglichkeiten, Kunstwerken oder Wasserinstallationen
-
Barrierefrei zugänglich
-
Geringer Pflege- und Verwaltungsaufwand
Beispielhafte Einsatzorte:
-
Zwischen Wohnhäusern
-
In Innenhöfen
-
Auf ehemaligen Parkplatzflächen
-
Neben Bushaltestellen oder Bahnhöfen
-
In der Nähe von Schulen oder Seniorenzentren
Fazit:
Pocket Parks sind eine kosteneffiziente und flexible Möglichkeit, um mehr Grün in verdichtete Stadtgebiete zu bringen. Sie sind ein wichtiges Instrument nachhaltiger Stadtentwicklung, insbesondere angesichts von Klimawandel, Urbanisierung und wachsendem Bedarf an öffentlichem Raum.