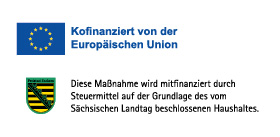Erzgebirgeatlas der TU Dresden – Kartenwerk mit Herz für den ländlichen Raum
Wer das Erzgebirge nur mit Nussknackern, Schwibbögen und weihnachtlichem Lichterglanz verbindet, sieht nur einen kleinen Ausschnitt dieser Region. Der Erzgebirgeatlas der TU Dresden will genau hier ansetzen: Er will ein vielschichtiges, aktuelles und ungeschöntes Bild des Erzgebirges zeichnen – und dabei Klischees hinter sich lassen.
Ein Atlas als Einladung zum Mitdenken
Das Projekt wurde am Lehrstuhl für Urbanismus und Entwerfen der TU Dresden unter der Leitung von Prof. Melanie Humann entwickelt. Statt eines klassischen Atlanten mit starren Karten versteht sich der Erzgebirgsatlas als offener Wissensspeicher. Er sammelt geografische Daten, persönliche Geschichten, statistische Analysen und visuelle Experimente – und verwebt sie zu einem Atlas, der zum Entdecken, Staunen und Diskutieren einlädt.
Studierende als Forscher und Erzähler
Die Basis des Atlas ist die Arbeit der Studierenden. In mehreren Semestern machten sie sich auf in die Region – nicht nur mit Kamera und Notizblock, sondern auch mit Neugier und einem offenen Ohr.
-
Sie führten Interviews mit Bewohnerinnen und Bewohnern.
-
Sie unternahmen Feldforschungen zu Themen wie Mobilität, Rohstoffabbau, Tourismus oder Naturraumschutz.
-
Sie erprobten neue Kartierungsformen, die auch emotionale und narrative Aspekte aufnehmen.
Das Ergebnis sind rund zwanzig Themenkarten, ergänzt durch Essays, Grafiken und kurze Reportagen.
Mehr als Papier – Wanderausstellung und Dialog
Ein zentrales Konzept ist die Rückführung der Ergebnisse in die Region: Der Atlas wird nicht nur als Druckwerk, sondern auch als Wanderausstellung präsentiert. Stationen waren unter anderem Museen und öffentliche Orte im Erzgebirge. Vor Ort kommen Bürgerinnen und Bürger ins Gespräch mit den Studierenden – bringen eigene Sichtweisen ein, korrigieren, ergänzen oder erweitern.
So wächst der Atlas weiter – nicht nur im Seminarraum, sondern durch direkten Dialog mit der Bevölkerung.
Konzeptionelle Ansätze
Der Erzgebirgsatlas ruht auf mehreren Säulen:
-
Offenheit – kein abgeschlossenes Werk, sondern ein sich entwickelnder Wissensspeicher.
-
Transdisziplinarität – Verbindung von Geografie, Architektur, Sozialwissenschaft, Design und Storytelling.
-
Partizipation – regionale Akteure werden nicht nur befragt, sondern aktiv eingebunden.
-
Visuelle Vielfalt – von klassischen Karten bis zu infografischen Experimenten und Fotostrecken.
Warum das wichtig ist
Das Erzgebirge steht wie viele ländliche Regionen vor Herausforderungen: Strukturwandel, demografische Veränderungen, Klimafragen. Der Atlas bietet eine Plattform, um diese Themen sichtbar zu machen und sie gemeinsam zu diskutieren. Er ist ein Werkzeug für Forschung, aber auch für die regionale Selbstwahrnehmung – und vielleicht sogar für neue Zukunftsperspektiven.
Ausblick
Geplant ist, den Atlas digital zugänglich zu machen und mit Zukunftswerkstätten weiterzuentwickeln. So soll das Projekt langfristig ein Bindeglied zwischen Universität, Forschung und regionaler Öffentlichkeit bleiben.
Der Erzgebirgsatlas zeigt: Karten können mehr sein als Wegweiser – sie können Geschichten erzählen, Brücken schlagen und Räume neu erlebbar machen.